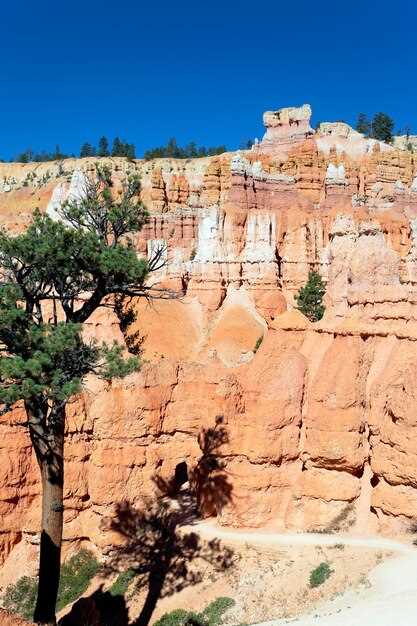Wer sich für die Herkunft der Erft interessiert, dem sei der Besuch des Quellbereichs bei Holzmülheim empfohlen. Dort, auf den Kalkplateaus der Eifel, tritt das Wasser an die Oberfläche – ein Phänomen, das Hydrologen wie Professor Lüttig schon in den 1960ern intensiv studierten. Die Ergiebigkeit der Quelle schwankt stark, beeinflusst durch Niederschläge und die geologischen Verhältnisse des Karstgesteins.
Die Beschaffenheit der Erft unterliegt im Verlauf ihres Laufs erheblichen Veränderungen. Von einem naturnahen Bachbett in der Eifel wandelt sie sich zu einem kanalisierten Gewässer in der Niederrheinischen Bucht. Besonders problematisch sind die anthropogenen Einflüsse, etwa die Einleitung von Kühlwasser aus Braunkohlekraftwerken, die die Temperatur und Sauerstoffsättigung signifikant beeinflussen.
Ihre Relevanz manifestiert sich in verschiedener Hinsicht. Einerseits ist sie für die Bewässerung der Landwirtschaft von Bedeutung, andererseits dient sie der Energiegewinnung. Nicht zu vergessen ist ihre ökologische Funktion als Lebensraum für eine Vielzahl von Arten, wenngleich diese durch die genannten Belastungen stark beeinträchtigt ist. Eine Renaturierung, wie sie beispielsweise von Dr. Matthias Otto angestrebt wird, ist daher unerlässlich.
Die Lebensader Erft: Quellort, Wesen, Relevanz
Für eine optimale Wasserqualität der Erft empfiehlt sich die Ansiedlung von Ufergehölzen, ähnlich den Prinzipien, die Prof. Dr. Ellenberg für ökologische Ausgleichsmaßnahmen propagierte. Die Quelle, lokal als Erftsprung bekannt, speist sich aus Karstgrundwasser des Zülpicher Börde.
Chemisch-physikalische Analysen, durchgeführt nach DIN-Normen, belegen eine hohe Wasserhärte im Quellbereich, bedingt durch gelöstes Calciumcarbonat. Dies ist charakteristisch für Kalkgesteinsgebiete, wie sie auch im Einzugsgebiet des Flüsschens vorherrschen. Der Gewässerzustand, beeinflusst durch landwirtschaftliche Nutzung, erfordert eine stetige Kontrolle der Nitratwerte, analog zu den Überwachungsstandards des LANUV NRW.
Die ökologische Bedeutung des Fließgewässers manifestiert sich in seiner Funktion als Lebensraum für diverse Fischarten, darunter Bachforelle (Salmo trutta fario) und Gründling (Gobio gobio). Bestandserhebungen, wie sie z.B. von Fischereibiologen nach Petersen-Markierung durchgeführt werden, dokumentieren die Artenvielfalt und deren Beeinträchtigungen.
Wo speist sich der Bach?
Die Quellzone der Erft liegt im Naturpark Nordeifel, genauer gesagt, nahe Holzmühlheim, einem Ortsteil von Nettersheim. Die Austrittspunkte des Wassers verteilen sich auf ein Areal, das sich in einem ehemaligen Kalksteinbruch befindet. Man spricht von einer rheokrenen Quelle, da das Wasser nicht aus einem einzelnen Punkt austritt, sondern diffus aus dem Untergrund quillt. Dieser Bereich ist als Quellsumpf ausgebildet.
Die Ergiebigkeit schwankt jahreszeitlich. Dipl.-Ing. Karl-Heinz Manhold erforschte die hydrologischen Zusammenhänge der Region ausführlich. Seine Arbeiten belegen, dass Niederschläge im Einzugsgebiet, insbesondere in den höher gelegenen Karstgebieten, maßgeblich die Quellschüttung beeinflussen. Das Wasser versickert im porösen Kalkgestein und tritt an den undurchlässigen Tonschichten wieder aus. Die Gebrüder Grimm hätten ihre Freude an dieser romantischen Stätte gehabt.
Für Besucher ist der Quellbereich zugänglich. Ein Lehrpfad informiert über die spezielle Geologie und Flora der Region. Es empfiehlt sich, festes Schuhwerk zu tragen, da das Gelände teilweise feucht ist. Die genaue GPS-Koordinate der Quellregion lautet beispielsweise 50.524° N, 6.628° O (ungefähre Angabe).
Wie sich die Flusssohle der Erft wandelt
Die Flusssohle reagiert dynamisch auf anthropogene Eingriffe und hydrologische Extreme. Starke Regenfälle (wie beim Hochwasser 2021) mobilisieren große Mengen Sediment, was zu einer Aufhöhung der Sohle in bestimmten Abschnitten (vor allem im Unterlauf) führt. Dies reduziert die Abflusskapazität.
Regulierungsmaßnahmen (Uferbefestigungen, Begradigungen) destabilisieren die Sohle langfristig. Erosion tritt verstärkt dort auf, wo die Fließgeschwindigkeit erhöht wird. Dies führt zur Freilegung von Grobkies und Fels.
Bergbauaktivitäten im Einzugsgebiet (Braunkohle) beeinflussen die Grundwasserstände. Sinkende Pegel können zu Austrocknung und einer Verfestigung der Sedimente im Flussbett führen. Dies erschwert die natürliche Regeneration der Gewässersohle.
Empfehlungen zur Beobachtung und Bewertung:
| Parameter | Messmethode | Häufigkeit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Sohlenhöhe | Pegelmessungen, Querprofile | Jährlich, nach Hochwasser | Referenzpunkte: Festpunkte an Brücken, Ufermauern |
| Korngrößenzusammensetzung | Siebanalyse von Sohlproben | Alle 5 Jahre | Entnahme an repräsentativen Stellen (Wechselbereiche, Stillwasserzonen) |
| Organische Substanz | Glühverlust, TOC-Analyse | Jährlich | Indikator für Verunreinigungen, Abbauprozesse |
| Befestigungen | Visuelle Inspektion, Drohnenbefliegung | Halbjährlich | Dokumentation von Schäden, Erosion |
Die Flussmorphologie ähnelt in bestimmten Abschnitten der von Flüssen in den Alpen, allerdings mit geringerem Gefälle. Eine angepasste Renaturierung, wie sie beispielsweise von Professor Habersack (TU München) für alpine Flüsse entwickelt wurde, kann auch hier zur Stabilisierung beitragen.
Welche Tiere und Pflanzen leben in der Erft?
Die Fauna der Erft profitiert von Renaturierungsmaßnahmen. Fischereibiologisch ist die Erft ein typisches Barbenflussrevier. Neben der Leitfischart Barbe (Barbus barbus) kommen Döbel (Squalius cephalus), Gründling (Gobio gobio), Hasel (Leuciscus leuciscus), Rotauge (Rutilus rutilus) und vereinzelt auch Bachforelle (Salmo trutta fario) vor. In den strukturreicheren Abschnitten finden sich auch Groppe (Cottus gobio), ein Indikator für gute Wasserqualität. Aale (Anguilla anguilla) werden regelmäßig besetzt, da die Durchgängigkeit flussaufwärts noch eingeschränkt ist.
Krebse und Kleinlebewesen
Der amerikanische Kamberkrebs (Faxonius limosus) hat sich als Neozoon etabliert, konkurriert aber mit dem heimischen Edelkrebs (Astacus astacus). Bezüglich der Makrozoobenthos-Gemeinschaft (Kleinstlebewesen am Gewässergrund) dominieren Köcherfliegenlarven (Trichoptera), Eintagsfliegenlarven (Ephemeroptera) und verschiedene Schneckenarten. Die Artenzusammensetzung spiegelt die Belastung mit Nährstoffen wider, wobei die Diversität in renaturierten Bereichen deutlich höher ist.
Vegetation
Die Ufervegetation wird von Weidengebüschen (Salix spp.) und Erlen (Alnus glutinosa) geprägt. In den flacheren Zonen siedeln sich Röhrichtbestände mit Rohrkolben (Typha latifolia) und Schilf (Phragmites australis) an. Unterwasserpflanzen wie das Laichkraut (Potamogeton spp.) verbessern die Sauerstoffversorgung und bieten Fischen Versteckmöglichkeiten. Die Zusammensetzung der Vegetation ändert sich mit dem Gefälle und der Wasserqualität, wie K. Hübener in seinen Arbeiten zur Fließgewässerökologie demonstriert hat.
Welche Bedeutung hat die Erft für die Region?
Die Erft, als Lebensader der Region, sichert die Trinkwasserversorgung durch Grundwasseranreicherung, vergleichbar mit den Techniken, die Karl Imhoff für die Ruhr entwickelte. Für Ackerbauern im Rhein-Kreis Neuss, etwa bei Korschenbroich, ist die Bewässerung mit Erftwasser, trotz der Herausforderungen durch den Tagebau, existentiell. Ohne sie wäre der lukrative Anbau von Gemüse, wie Spargel, undenkbar.
Industrielle Nutzung und Auswirkungen
Die Energieerzeugung, beispielsweise durch Wasserkraftwerke in Grevenbroich, profitiert unmittelbar vom Wasserlauf. Allerdings führt der Braunkohleabbau zu massiven Eingriffen. Die Umsiedlung von Ortschaften wie Immerath und der damit verbundene Verlust fruchtbaren Ackerlandes sind direkte Konsequenzen. Die hydrologischen Veränderungen, die dadurch entstehen, erfordern ständige Anpassungen in der Wasserwirtschaft, ähnlich den Herausforderungen, mit denen sich bereits Wilhelm Mulhofer bei der Regulierung der Emscher konfrontiert sah.
Erholung und Tourismus
Die Erftauen bieten Radfahrern und Wanderern, ähnlich wie am Rhein, naturnahe Erholungsgebiete. Die Renaturierungsprojekte, wie sie beispielsweise entlang der Mündungsbereiche in den Rhein umgesetzt wurden, tragen zur Steigerung der Attraktivität bei. Dadurch wird der sanfte Tourismus gefördert und somit auch die regionale Wirtschaft gestärkt.
Wie wird die Erft geschützt?
Die Renaturierung, à la Tiemann, ist der Eckpfeiler: Konkret bedeutet dies die Entfernung von Uferbefestigungen, Schaffung von Flachwasserzonen und Mäandern. Dies fördert die Selbstregulation des Gewässers und bietet Laichplätze für Fischarten wie die Barbe.
Die Reduktion von Nährstoffeinträgen, besonders Nitrate aus der Landwirtschaft, erfolgt durch Ausweisung von Wasserschutzgebieten mit strengen Auflagen für die Düngung nach Düngeverordnung (DüV). Kontrollen durch die Landwirtschaftskammer NRW sind obligatorisch.
Die Aufwertung der Gewässerstruktur, vergleichbar mit den Arbeiten von Sukopp in Berlin, beinhaltet das Einbringen von Totholzstrukturen und Kiesbänken. Dies erhöht die Strukturvielfalt und dient als Lebensraum für Kleinstlebewesen und Insektenlarven – wichtige Nahrungsquellen für Fische.
Das Monitoring der Wasserqualität, ähnlich dem System, das Schmitz im Rheinland etablierte, erfolgt durch regelmäßige chemische und biologische Untersuchungen. Die Ergebnisse werden öffentlich zugänglich gemacht und dienen als Grundlage für Anpassungen der Schutzmaßnahmen.
Die Sensibilisierung der Bevölkerung, angelehnt an die Projekte von Reichholf, wird durch Informationsveranstaltungen, Exkursionen und die Einbindung lokaler Vereine vorangetrieben. Dies fördert das Verständnis für die Zusammenhänge im Ökosystem und die Notwendigkeit des Gewässerschutzes.
Fragen und Antworten:
Wo genau liegt die Erftquelle und wie zugänglich ist sie für Besucher?
Die Erftquelle befindet sich in Holzmülheim, einem Ortsteil von Nettersheim in der Eifel. Sie ist relativ leicht zugänglich. Es gibt einen Wanderweg, der direkt zur Quelle führt. Vor Ort findet man Informationstafeln, die Auskunft über die geologischen und hydrologischen Besonderheiten des Gebiets geben. Die unmittelbare Umgebung der Quelle ist naturbelassen, sodass Besucher die Ursprünglichkeit des Flusses erleben können.
Welche besondere geologische Formationen tragen zur Entstehung der Erftquelle bei?
Die Entstehung der Erftquelle ist eng mit dem Karstgestein der Region verbunden. Das Wasser sickert durch Spalten und Klüfte im Kalkgestein und sammelt sich unterirdisch. An der Stelle der Quelle tritt das Wasser dann wieder an die Oberfläche. Diese Karstlandschaft ist charakteristisch für die Eifel und beeinflusst die Wasserqualität und -menge der Erft.
Welche Tier- und Pflanzenarten sind typisch für das Ökosystem rund um die Erft?
Das Ökosystem entlang der Erft beheimatet eine Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten. In den Uferzonen findet man typische Feuchtgebietsgewächse wie Seggen, Binsen und Weiden. Im Wasser leben verschiedene Fischarten, darunter Bachforellen und Groppen. Auch Insekten wie Köcherfliegen und Libellen sind hier anzutreffen. Besonders schützenswert sind die Auenlandschaften entlang des Flusses, die als Lebensraum für seltene Vogelarten dienen.
Inwiefern hat die Nutzung der Erft durch den Menschen die Natur des Flusses beeinflusst?
Die Nutzung der Erft durch den Menschen hat im Laufe der Jahrhunderte deutliche Spuren hinterlassen. Früher wurden Wassermühlen betrieben, was den Flusslauf veränderte. Heute wird das Wasser unter anderem für die Landwirtschaft und die Kühlung von Industrieanlagen genutzt. Dies kann zu einer Beeinträchtigung der Wasserqualität und des Wasserhaushaltes führen. Maßnahmen zur Renaturierung sollen diese negativen Auswirkungen reduzieren und die ökologische Vielfalt der Erft wiederherstellen.
Welche Bedeutung hat die Erft für die Region aus historischer und kultureller Sicht?
Die Erft hat eine lange Geschichte als wichtiger Faktor für die Besiedlung und wirtschaftliche Entwicklung der Region. Entlang des Flusses entstanden Siedlungen und Gewerbebetriebe, die das Wasser als Energiequelle und Transportweg nutzten. Zahlreiche Burgen und Schlösser säumen das Erfttal und zeugen von der historischen Bedeutung des Flusses. Auch in der lokalen Folklore und im Brauchtum spielt die Erft eine Rolle. Sie ist ein fester Bestandteil der regionalen Identität.