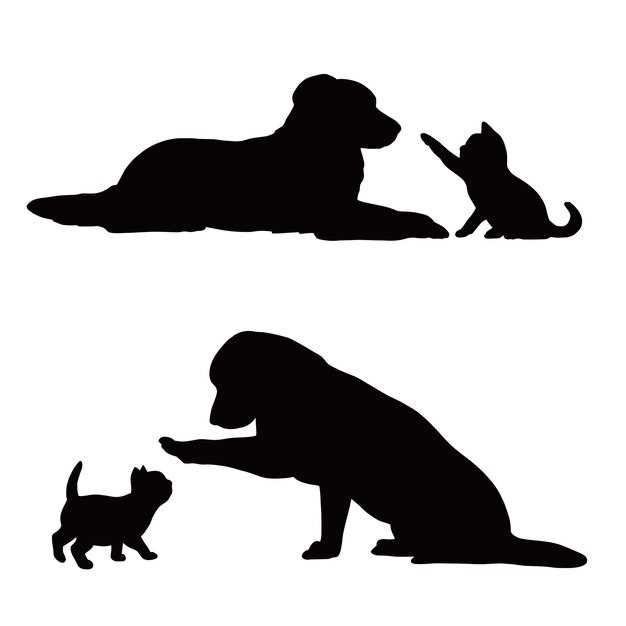Wer einen lebhaften, intelligenten und territorialen Hofhund sucht, findet im Appenzeller Treibhund den idealen Gefährten. Die Selektion dieser Rasse erfolgte traditionell auf Arbeitsleistung, was sich in einem ausgeprägten Schutztrieb und einer hohen Lernbereitschaft äußert. Achtung: Konsequente Erziehung ist unerlässlich, da der ursprüngliche Hüteinstinkt bei unzureichender Führung unerwünschte Verhaltensweisen entwickeln kann, wie beispielsweise das Treiben von Autos oder Fahrrädern. Empfehlenswert sind Trainingsmethoden nach Turid Rugaas, die auf positiver Verstärkung und dem Verständnis der hündischen Körpersprache basieren.
Die Reinzucht des Appenzellers obliegt strengen Kriterien des Schweizerischen Klubs für Appenzeller Treibhunde (SKAT). Augenmerk liegt auf der Gesundheit der Elterntiere, insbesondere der Hüftgelenksdysplasie (HD) und Ellenbogendysplasie (ED). Vor dem Erwerb eines Welpen ist ein Blick in die Zuchtpapiere und Gesundheitszeugnisse unerlässlich. Seriöse Züchter wie Familie Müller-Röthlisberger in Appenzell legen Wert auf eine umfassende Sozialisierung der Welpen bereits im frühen Alter, um späteren Verhaltensproblemen vorzubeugen. Der VDH bietet ebenfalls Zuchtordnungen an, die als Orientierung dienen können, aber die SKAT-Standards sind maßgeblich.
Das dichte, stockhaarige Fell des Appenzellers ist pflegeleicht, erfordert jedoch regelmäßiges Bürsten, besonders während des Fellwechsels. Die Ernährung sollte auf die hohe Aktivität des Hundes abgestimmt sein. Hochwertiges Futter mit einem hohen Fleischanteil ist empfehlenswert. Achten Sie auf eine ausgewogene Zusammensetzung, um Mangelerscheinungen vorzubeugen. Ein Tierarzt kann Ihnen bezüglich der individuellen Futterbedürfnisse Ihres Hundes beraten. Bewegung ist das A und O: Der Appenzeller braucht tägliche, ausgiebige Spaziergänge und geistige Auslastung, idealerweise durch Hundesportarten wie Agility oder Obedience. Ohne ausreichende Beschäftigung neigt er zu Unruhe und Zerstörungswut.
Wie erkenne ich einen gesunden Junghund der Rasse beim Aufzüchter?
Achten Sie auf ein glänzendes, dichtes Fell ohne kahle Stellen, was auf eine gute Ernährung und das Fehlen von Ektoparasiten wie Milben (z.B. Demodex) oder Flöhen hindeutet. Die Augen müssen klar und frei von Ausfluss sein. Tränende oder verklebte Augen können ein Zeichen für eine Konjunktivitis oder andere Augenprobleme sein, wie sie Dr. Formston in seiner Arbeit über Augenkrankheiten bei Rassehunden beschreibt.
Überprüfen Sie die Ohren auf Sauberkeit und das Fehlen von übermäßigem Ohrenschmalz, Rötungen oder unangenehmen Geruch. Diese Anzeichen könnten auf eine Otitis externa hindeuten. Palpieren Sie vorsichtig den Bauch; er sollte weich und nicht aufgebläht sein. Ein harter oder schmerzempfindlicher Bauch kann auf Wurmbefall oder andere gastrointestinale Probleme hinweisen, die Dr. Urquhart in „Parasitology for Veterinarians“ detailliert behandelt.
Beobachten Sie die Art der Bewegung. Der junge Vierbeiner sollte sich frei und ohne Lahmheit bewegen. Achten Sie auf korrekte Winkelung der Gliedmaßen und einen geraden Rücken. Eine abnormaler Gang kann auf Hüftdysplasie (HD) oder Ellenbogendysplasie (ED) hinweisen, Erkrankungen, die laut Dr. Brass häufig bei großen Hunderassen vorkommen. Lassen Sie sich die HD/ED-Befunde der Elterntiere zeigen.
Prüfen Sie das Gebiss auf Vollständigkeit und korrekten Scherenbiss. Zahnfehlstellungen oder das Fehlen von Zähnen können auf genetische Defekte hindeuten. Ein Züchter, der Wert auf die Einhaltung des Rassestandards legt, wird dies berücksichtigen. Kontrollieren Sie, ob der Welpe geimpft und entwurmt wurde und lassen Sie sich die entsprechenden Nachweise (Impfpass, Wurmkur-Protokoll) zeigen.
Beurteilen Sie das Verhalten des Hundekindes. Er sollte aufmerksam, neugierig und verspielt sein, aber nicht übermäßig ängstlich oder aggressiv. Ein gesundes, selbstbewusstes Wesen ist ein gutes Zeichen für eine artgerechte Aufzucht und Sozialisierung, wie sie von Campbell in „Dog Problems“ beschrieben wird.
Welche Wesenszüge machen den Gebirgshund zum idealen Familiengefährten (und wann nicht)?
Ein ausgeprägter Schutztrieb und hohe Lernbereitschaft prädestinieren den Vierbeiner als loyalen Begleiter, insbesondere für Familien mit älteren Kindern (ab ca. 8 Jahren). Seine Robustheit und Ausdauer erlauben intensive Outdoor-Aktivitäten. Ideal ist ein Haus mit Garten, da er viel Bewegungsfreiheit benötigt.
Ideal: Familien, die konsequente Führung bieten können und bereit sind, Zeit in Erziehung und Beschäftigung zu investieren. Sportliche Familien, die den Hund in ihre Aktivitäten (Wandern, Agility) einbeziehen. Erfolgreiche Beispiele sind die Familien, die ihre Tiere im Hundesport führen und regelmäßig bei Wettbewerben nach den Richtlinien der VDH teilnehmen.
Nicht ideal: Für unerfahrene Hundehalter oder Familien mit Kleinkindern, da der Vierbeiner eine starke Führungspersönlichkeit benötigt. Seine territoriale Veranlagung kann bei unzureichender Sozialisierung zu Problemen mit anderen Hunden führen. Ein Mangel an mentaler und physischer Auslastung kann zu unerwünschtem Verhalten (Bellen, Zerstörung) führen, wie auch schon bei den Arbeiten von Trumler deutlich wurde.
Wichtig: Frühzeitige Sozialisierung (Welpenstunde, Junghundekurse) und konsequente Erziehung sind unerlässlich. Die Anleitung durch einen erfahrenen Hundetrainer oder Verhaltensberater (z.B. nach den Prinzipien von Bloch) ist empfehlenswert.
Die korrekte Erziehung des Appenzellers: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Anfänger
Beginnen Sie mit der Sozialisierung des Welpen ab der 8. Lebenswoche. Präsentieren Sie ihm verschiedene Umgebungen, Geräusche und Menschen. Dies ist entscheidend, um Ängstlichkeit und Aggression im Erwachsenenalter zu vermeiden. Nutzen Sie Welpenspielgruppen unter Aufsicht erfahrener Trainer.
Der junge Vierbeiner benötigt klare Regeln und Konsequenz. Verwenden Sie positive Verstärkung (Lob, Leckerlis) für erwünschtes Verhalten. Vermeiden Sie Strafen, die zu Angst und Misstrauen führen können. Orientieren Sie sich an den Prinzipien des operanten Konditionierens nach Skinner.
Bringen Sie dem Hund die Grundkommandos („Sitz“, „Platz“, „Bleib“, „Hier“) bei. Beginnen Sie in einer ablenkungsarmen Umgebung und steigern Sie den Schwierigkeitsgrad allmählich. Kurze Trainingseinheiten (5-10 Minuten) sind effektiver als lange.
Die Rasse hat einen ausgeprägten Hütetrieb. Lenken Sie diesen Trieb in positive Bahnen, z.B. durch Treibball oder Agility. Fördern Sie die Zusammenarbeit durch Gehorsamsübungen und Tricktraining.
Achten Sie auf eine artgerechte Auslastung. Der Vierbeiner benötigt sowohl körperliche als auch geistige Herausforderungen. Lange Spaziergänge, Suchspiele und interaktives Spielzeug sind geeignet.
Frühzeitiges Training des Rückrufs ist essenziell. Nutzen Sie eine Schleppleine, um den Hund in sicherer Umgebung abzurufen und belohnen Sie ihn überschwänglich, wenn er gehorcht.
Ignorieren Sie unerwünschtes Verhalten (z.B. Anspringen) konsequent. Drehen Sie sich weg und vermeiden Sie Blickkontakt. Sobald der Hund sich beruhigt hat, können Sie ihm Ihre Aufmerksamkeit schenken.
Suchen Sie bei Problemen professionelle Hilfe. Ein erfahrener Hundetrainer oder Verhaltensberater kann Ihnen individuelle Tipps und Ratschläge geben, beispielsweise durch Analyse des problematischen Verhaltens wie es von Turid Rugaas empfohlen wird.
Die konsequente Umsetzung dieser Schritte führt zu einem ausgeglichenen und gehorsamen Hund, der ein angenehmer Begleiter ist. Investieren Sie Zeit und Geduld in die Erziehung – es lohnt sich!
Fellpflege, Ernährung & Co.: Was braucht mein Vierbeiner wirklich?
Bürsten Sie das Fell des Berglers idealerweise 2-3 Mal wöchentlich mit einer Zupfbürste und einem Gummistriegel, um lose Haare zu entfernen und die Durchblutung anzuregen. Während des Fellwechsels im Frühjahr und Herbst ist tägliches Bürsten ratsam. Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Hundeshampoo mit neutralem pH-Wert; häufiges Baden trocknet die Haut aus.
Die Fütterung sollte sich am Aktivitätslevel und Alter des Hundes orientieren. Hochwertiges Trockenfutter mit einem hohen Fleischanteil (mindestens 70%) ist empfehlenswert. Achten Sie auf eine ausgewogene Zusammensetzung mit Proteinen (22-28%), Fetten (12-18%) und Kohlenhydraten. Vermeiden Sie Füllstoffe wie Mais, Weizen oder Soja. Dr. Ian Billinghurst, ein Pionier der Rohfütterung (BARF), empfiehlt die Fütterung von rohem Fleisch, Knochen und Gemüse zur optimalen Versorgung. Die Tagesration sollte auf zwei Mahlzeiten verteilt werden, um das Risiko einer Magendrehung zu minimieren.
Die Krallenpflege ist ein wichtiger Aspekt. Kontrollieren Sie die Krallen regelmäßig und kürzen Sie sie bei Bedarf mit einer Krallenzange. Achten Sie darauf, nicht zu viel zu entfernen, um Verletzungen zu vermeiden. Bei Hunden, die viel auf hartem Untergrund laufen, ist das Kürzen möglicherweise seltener erforderlich.
Regelmäßige Wurmkuren (alle 3 Monate) und Impfungen sind unerlässlich. Sprechen Sie mit Ihrem Tierarzt über einen individuellen Impfplan und geeignete Präventivmaßnahmen gegen Parasiten wie Zecken und Flöhe. Bei Anzeichen von Ohrenentzündungen (z.B. Rötung, Juckreiz, Ausfluss) ist eine tierärztliche Behandlung notwendig. Reinigen Sie die Ohren bei Bedarf mit einem speziellen Ohrenreiniger für Hunde.
Typische Krankheiten des Appenzeller Vierläufers: Worauf muss ich achten?
Achten Sie primär auf Hüftdysplasie (HD) und Ellbogendysplasie (ED). Regelmäßige Röntgenuntersuchungen ab dem 12. Lebensmonat, beurteilt nach FCI-Standard, sind ratsam. Züchter sollten ausschließlich Elterntiere mit HD-freien oder HD-C (Übergangsform) Befunden verwenden, wie von Professor Brass empfohlen.
Progressive Retinaatrophie (PRA) ist eine weitere Gefahr. Ein jährlicher Augencheck durch einen DOK-zertifizierten Tierarzt ist unerlässlich, um frühzeitig Veränderungen festzustellen. Vermeiden Sie Verpaarungen von Trägertieren, erkennbar durch DNA-Tests.
Ebenfalls relevant ist das Glaukom (Grüner Star), das bei dieser Rasse vermehrt auftritt. Achten Sie auf Anzeichen wie gerötete Augen, Lichtscheu oder getrübte Hornhaut. Eine frühzeitige Diagnose durch Tonometrie (Augeninnendruckmessung) ist entscheidend für den Therapieerfolg.
Einige Linien zeigen eine Prädisposition für Autoimmunerkrankungen wie die canine Dermatomyositis. Achten Sie auf Hautveränderungen, insbesondere an Gesicht, Ohren und Pfoten. Eine frühzeitige Diagnose und immunsuppressive Therapie, beispielsweise mit Prednisolon, können den Verlauf mildern.
Die idiopathische Epilepsie kann ebenfalls vorkommen. Bei wiederholten Krampfanfällen ist eine neurologische Untersuchung, inklusive MRT, angezeigt. Eine medikamentöse Einstellung mit Phenobarbital oder Imepitoin ist oft notwendig, um die Anfallshäufigkeit zu reduzieren. Konsultieren Sie einen erfahrenen Veterinärneurologen.
Fragen und Antworten:
Ich wohne in einer kleinen Stadtwohnung. Ist ein Appenzeller Sennenhund überhaupt eine gute Wahl für mich?
Ein Appenzeller Sennenhund ist ein aktiver und arbeitsfreudiger Hund, der viel Bewegung und geistige Auslastung braucht. Eine kleine Stadtwohnung ist daher grundsätzlich nicht der ideale Lebensraum. Diese Hunde brauchen Platz zum Toben und Aufgaben, die sie fordern. Wenn du dem Hund täglich ausreichend Auslauf und Beschäftigung bieten kannst (mehrere Stunden intensives Training, lange Spaziergänge, Hundesport usw.), KANN es funktionieren. Aber sei ehrlich zu dir selbst: Hast du wirklich die Zeit und die Energie, diesen Bedürfnissen gerecht zu werden? Wenn nicht, ist es besser, sich für eine andere, weniger anspruchsvolle Rasse zu entscheiden. Bedenke auch die Lautstärke: Appenzeller sind wachsam und neigen zum Bellen, was in einer Mietwohnung zu Problemen führen kann. Informiere dich gründlich, bevor du dich entscheidest!
Ich habe Kinder. Sind Appenzeller Sennenhunde kinderfreundlich?
Appenzeller Sennenhunde können gute Familienhunde sein, wenn sie von klein auf richtig sozialisiert und erzogen werden. Sie sind oft loyal und beschützend gegenüber ihren Familien. Es ist aber sehr wichtig, dass Kinder den respektvollen Umgang mit Hunden lernen und dass der Hund einen Rückzugsort hat, an dem er nicht gestört wird. Unbeaufsichtigtes Spielen von kleinen Kindern mit dem Hund sollte vermieden werden, da ein Appenzeller Sennenhund manchmal etwas stürmisch sein kann und nicht immer die Feinmotorik kleiner Kinder versteht. Eine frühe Sozialisierung mit Kindern unterschiedlichen Alters ist sehr ratsam.
Wie viel kostet ein Appenzeller Sennenhund Welpe von einem seriösen Züchter?
Die Kosten für einen Appenzeller Sennenhund Welpen von einem verantwortungsvollen Züchter können variieren, liegen aber in der Regel zwischen 1200 und 2000 Euro. Dieser Preis spiegelt die Kosten wider, die dem Züchter für die Aufzucht der Welpen entstehen: Tierärztliche Versorgung der Mutterhündin und der Welpen, hochwertiges Futter, Wurmkuren, Impfungen, Chip, Ahnentafel und die sorgfältige Auswahl der Elterntiere auf Gesundheit und Wesen. Billigere Angebote sollten skeptisch machen, da hier oft an der Gesundheit der Tiere gespart wird. Es ist besser, etwas mehr zu zahlen und einen gesunden und gut sozialisierten Welpen zu bekommen.
Welche typischen Krankheiten treten bei Appenzeller Sennenhunden häufig auf?
Wie viele andere Rassehunde, können auch Appenzeller Sennenhunde anfällig für bestimmte genetisch bedingte Krankheiten sein. Zu den häufigsten Problemen gehören Hüftdysplasie (HD), Ellenbogendysplasie (ED) und progressive Retinaatrophie (PRA), eine Augenerkrankung, die zur Erblindung führen kann. Seriöse Züchter lassen ihre Zuchttiere auf diese Krankheiten untersuchen, um das Risiko für die Welpen zu minimieren. Als zukünftiger Besitzer solltest du dich ebenfalls über diese Krankheiten informieren und bei der Auswahl des Züchters darauf achten, dass Gesundheitsuntersuchungen durchgeführt werden. Ein offenes Gespräch mit dem Züchter über potenzielle Risiken ist sehr wichtig.
Ich bin berufstätig und kann dem Hund nicht den ganzen Tag Gesellschaft leisten. Kann ich einen Appenzeller Sennenhund trotzdem halten?
Es kommt darauf an, wie lange der Hund alleine bleiben muss und wie du die Zeit gestaltest, wenn du zu Hause bist. Ein Appenzeller Sennenhund braucht viel Aufmerksamkeit und Beschäftigung. Wenn er regelmäßig lange Zeit alleine gelassen wird, kann er Verhaltensprobleme entwickeln, wie z.B. Zerstörungswut oder exzessives Bellen. Wenn du berufstätig bist, solltest du dir gut überlegen, ob du dem Hund wirklich gerecht werden kannst. Mögliche Lösungen wären z.B. ein Hundesitter, eine Hundetagesstätte oder die Möglichkeit, den Hund mit zur Arbeit zu nehmen. Alternativ kann es sinnvoll sein, sich nach einer Rasse umzusehen, die besser mit längeren Alleinzeiten zurechtkommt.